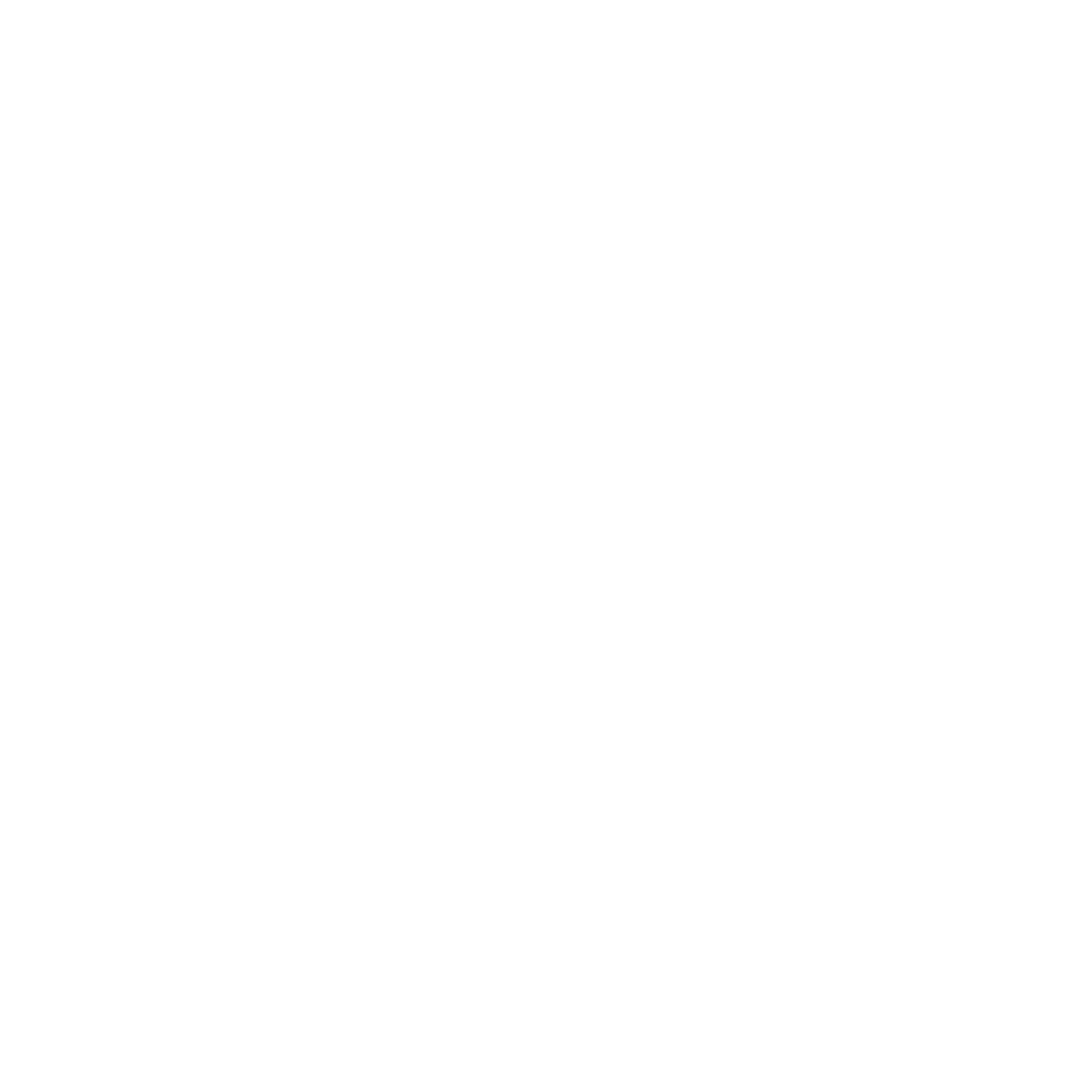Bis zu einem Viertel unserer Grundschüler können Ende der 4. Klasse nicht richtig lesen und rechnen. In der aktuellen PISA-Studie finden sich diese Zahlen für 15-Jährige wieder. Unter den 25 – 30-Jährigen haben 16% keinerlei Berufsabschluss. Die restlichen 9% befinden sich vermutlich in Maßnahmen der ARGE und werden nicht mitgezählt. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels ist das volkswirtschaftlich betrachtet Irrsinn!
Die Wissenschaft kennt die Kinder und Jugendlichen hinter diesen Zahlen seit der ersten PISA-Erhebung im Jahr 2000. Es sind nach wie vor Kinder aus bildungsfernen Schichten und solche mit Migrationshintergrund. Diese Kinder erreichen wir mit unserem bisherigen Verständnis von Unterricht ganz offensichtlich nicht.
Eine Erhöhung der Jahreswochenstunden ist grundsätzlich zu begrüßen. Diese Maßnahme könnte sich allerdings angesichts des weiterhin steigenden Lehrkräftemangels als gut gemeinte Absichtserklärung erweisen. Deshalb sollte das Ministerium parallel die sehr engen Vorgaben für die Beschäftigung von pädagogisch einsetzbarem Personal ändern, damit in multiprofessioneller Zusammenarbeit Lehrkräfte entlastet werden und sich auf ihr Kerngeschäft, den Unterricht, konzentrieren können.
Diese Stunden würden aber nicht viel bewirken, wenn Lehrkräfte nicht in die Lage versetzt werden, ihren Unterricht zu verändern. Dafür braucht einerseits deutlich weniger behördliche Vorgaben und andererseits regional verschieden mehr Freiheiten für die Schul- und Unterrichtsentwicklung. Erkenntnisse der Wissenschaft für guten Unterricht sollten im Kultusministerium handlungsleitend sein.
Und es braucht vielerorts eine veränderte pädagogische Haltung, damit alle Kinder sich angenommen fühlen können, ihre Wertschätzung nicht durch Noten ausgedrückt wird und irgendwann in Beschämung und damit einhergehend in Verweigerung umschlägt.
Für die Schulen hilfreich sind die vom Kultusministerium bereits zur Verfügung gestellten Diagnostikverfahren. Differenzierung muss dann in der Form stattfinden, dass ein Kind nicht im Gleichschritt mit allen anderen die gleichen Aufgaben bearbeiten muss. Kinder benötigen unterschiedlich viel Zeit. Wenn die Basiskompetenzen nicht gesichert sind, werden die Lücken in den Lernständen irgendwann so groß, dass nicht mehr darauf aufgebaut werden kann. In der Konsequenz darf ein Kind auch nicht am Tag X die gleiche Klassenarbeit schreiben müssen wie alle anderen, sondern erst dann, wenn die entsprechenden Kompetenzen auch beherrscht werden. Positive Ergebnisse motivieren, negative bewirken auf Dauer das Gegenteil.
Also: Gerne mehr Unterrichtsstunden. Allein diese Maßnahme wäre aber viel zu kurz gesprungen.
Der der SWK Fokus lag zuletzt leider weniger auf der Grundschule. Trotzdem macht die SWK schon gute Vorschläge auch für die Grundschule, hier Beispiele aus Dezember 2022:
„… Das Gutachten stellt die Diagnose und Förderung grundlegender sprachlicher und mathematischer Kompetenzen als zentrale Herausforderungen in den Mittelpunkt. Darüber hinaus formuliert die Kommission Empfehlungen zu strukturellen und organisatorischen Aspekten des Systems Grundschule. …
…Erhöhung der Unterrichtsqualität auf Basis evidenzbasierter Konzepte. Im Kern empfiehlt die SWK eine Verbesserung der Unterrichtsqualität. Prof. Dr. Michael Becker-Mrotzek, Direktor des Mercator-Instituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache und SWK-Mitglied: "Sowohl für den sprachlichen als auch den mathematischen Bereich gibt es wirksame Unterrichtskonzepte. Diese sollten Lehrkräfte systematisch im Unterricht einsetzen, um alle Schülerinnen und Schüler zu motivieren und zu aktivieren. Dazu gehört vor allem das regelmäßige und verstehensorientierte Üben der basalen Kompetenzen im Lesen, Zuhören, Schreiben und Rechnen." Die Erhöhung der Unterrichtsqualität setzt zum einen ausreichende Lernzeit voraus: Für das Fach Deutsch sollten 24, für das Fach Mathematik 20 Wochenstunden in den ersten vier Grundschuljahren zur Verfügung stehen. Zum anderen empfiehlt die SWK, den Lernstand der Kinder kontinuierlich zu prüfen, mit mehreren Diagnosezeitpunkten pro Schuljahr. …
…Mehr Investitionen für Personal und Schulen mit einem hohen Anteil an sozioökonomisch benachteiligten Schülerinnen und Schülern
Insbesondere hinsichtlich des Personals sieht die Kommission einen erhöhten Investitionsbedarf. Schulleitungen benötigen ausreichend Zeit für Leitungsaufgaben. Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte sollten über Kooperationszeit verfügen und für ihre komplexen Aufgaben angemessen besoldet werden. Die SWK empfiehlt zudem eine datenbasierte Unterrichts- und Schulentwicklung. Für die Koordination dieser Aufgaben sind in größeren Grundschulen Funktionsstellen, in kleineren Schulen Entlastungsstunden erforderlich. …“
Quellenangabe: https://www.kmk.org/aktuelles/artikelansicht/swk-empfiehlt-konzentration-auf-basale-kompetenzen-in-der-grundschule.html
Eine Kernforderung unseres Verbandes Leitungen Niedersächsischer Grundschulen – LNGS lautet:Grundschulleitungen benötigen Zeit, Unterrichtsentwicklung voranzutreiben. Aktuell stehen sie mir ihrer Belastung mit dem Rücken zur Wand und bewältigen nur noch irgendwie den Schulalltag.Oder es gibt gar keine Schulleitung, weil sich niemand findet, der sich das noch antun will. So werden Veränderungen nicht gelingen.
Pressemitteilung des Vorstands vom 21.12.2023